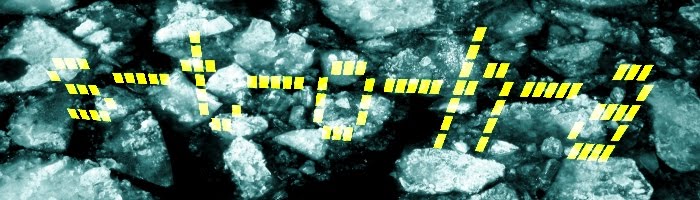Von Schrobers Ende gibt es verschiedene Versionen. Manche sagen, er sei einfach verschwunden, aber das ist unwahrscheinlich. Das passt nicht zu Schrober. Schrober verschwindet nicht einfach. Aber ich sollte nicht mit dem Ende beginnen, denn dann würde ich mit dem Anfang aufhören.
Am Anfang war Schrober eindeutig einer von uns. Er war wie wir alle, nur ein wenig anders. Er war dem Bier sehr zugeneigt. Das waren wir auch, sieht man von Haffner ab, der nur Mineralwasser und Pflaumensaft trank. Ich habe ihn, Haffner, nie mit einem anderen Getränk im Glas an einem Tisch sitzen sehen, als Mineralwasser oder Pflaumensaft. Da ich in einem normalen Supermarkt niemals Pflaumensaft gefunden habe, habe ich mich oft gefragt, wo er den Pflaumensaft bezog. Gab es spezielle Pflaumensaft-Dealer? Oder gar Pflaumensaft-Gangs? Aber selbstverständlich habe ich ihn nie darauf hin angesprochen.
Doch ich schweife ab. Ich will nicht von Haffner berichten, sondern von Schrober. Auch wenn ich diesen Exkurs damit rechtfertigen kann, Schrober dadurch in einen größeren Zusammenhang einzuordnen. Tatsächlich kann ich Schrober kaum durch Schrober selber erklären. Naturgemäß ist er, wie wir alle, ein Produkt seiner Umwelt. Dazu müsste ich natürlich noch Schmidt, Paulsen und weitere Personen erwähnen, die Schrober zu dem machten, was er war. Doch dazu später. Erst einmal muss ich klären, was an Schrober das Besondere war und warum ich ein simples Verschwinden als Erklärung nicht in Erwägung ziehen kann. Dies soll das Ziel meiner Erörterung sein.
Schrober war, wie bereits gesagt, einer von uns. Einer, der trank, wenn wir tranken. Einer, der aß, wenn wir aßen. Und wenn wir gar nichts taten, lag er ebenfalls tatenlos auf einem Sofa oder einem Bett und starrte wohin auch immer. Das war nichts besonders, denn wenn wir nichts taten, und das taten wir oft, starrten wir auch wo hin auch immer, meistens ins Leere und ließen in unseren Köpfen die Gedanken kreisen. Ich übertreibe nicht, wenn ich sage, dass das Kreisenlassen von Gedanken unsere Hauptbeschäftigung war.
Dass Haffner der Letzte war, der Schrober lebend gesehen hatte, war kein Zufall. Haffner war immer der hellste von uns. Wenn in unseren Köpfen schon nicht mehr die Gedanken, sondern nur noch gleichmäßige Alphawellen ihre Kreise zogen, kamen ihm, Haffner, noch immer Ideen. Wir vermuteten immer, dass da etwas mit ihm nicht stimmte, dass er niemals in den Rhythmus kam, wie wir andere. Selbst Schrober fand immer irgendwann der Rhythmus, klinkte sich ein in unsere Gemeinschaft und ließ die Alphawellen zirkulieren.
Je länger wir uns kannten, desto weniger sprachen wir. Vielleicht ist das der natürliche Gang der Freundschaft. Vielleicht war es auch nur bei uns so. Früher sprachen wir viel und erzählten uns aus unserer Kindheit. Später saßen wir herum, tranken Bier, Mineralwasser oder Pflaumensaft und beobachteten wortlos wie die Staubkörner sich zu Staubmäusen formten, Nester bildeten und dann langsam, wie in Zeitlupe die Wände hinab glitten. Anfangs sahen wir uns noch von Zeit zu Zeit dabei an, manche, vor allem Paulsen, nickten wissend, wenn sich die Blicke trafen. Später wurde der Rhythmus wichtiger. Blicke wurden belanglos und nur noch selten erwidert. Die Augen bildeten schließlich nur einen Bruchteil dessen ab, von dem, was uns umgab, was wichtig war. Blicke waren nur einfachste formale Gesten. Small Talk, gewissermaßen, auf den wir mehr und mehr verzichten konnten, wenn wir unter uns waren.
„N' rotes Taxi,“ sagte Haffner. Das war viel. Zu viel vielleicht, denn ich spürte, als er es sagte, wie ich augenblicklich aus dem Rhythmus kam. „N' rotes Taxi,“ hallte es in meinem Kopf nach. Noch immer höre ich das Echo, leiser inzwischen, aber immer noch meinen Geist bedrängend, meinen Intellekt fordernd. „N' rotes Taxi.“ Das war seine Antwort auf die Frage, wo Schrober bliebe. Warum er nicht hier wäre. Warum er nicht mit uns hier säße. Warum seine Schwingungen fehlten. Denn sie fehlten uns allen ganz fraglos.
Ein rotes Taxi hatte ihn also geholt. Was das bedeutete war uns allen klar. Das konnte nur das Taxi zum Trinkteufel sein. In den Trinkteufel hat es keiner von uns geschafft. „Geschlossen,“ hieß es immer, wenn wir das Lokal betreten wollten oder „Kein Bier mehr.“ Er hatte es also in den Trinkteufel geschafft, Schrober. Als einziger von uns. Dass er nicht mehr wiederkam war klar. Das war uns allen klar. Niemand kommt lebend aus dem Trinkteufel.
wtl | essen auf raedern
vor 2 Tagen